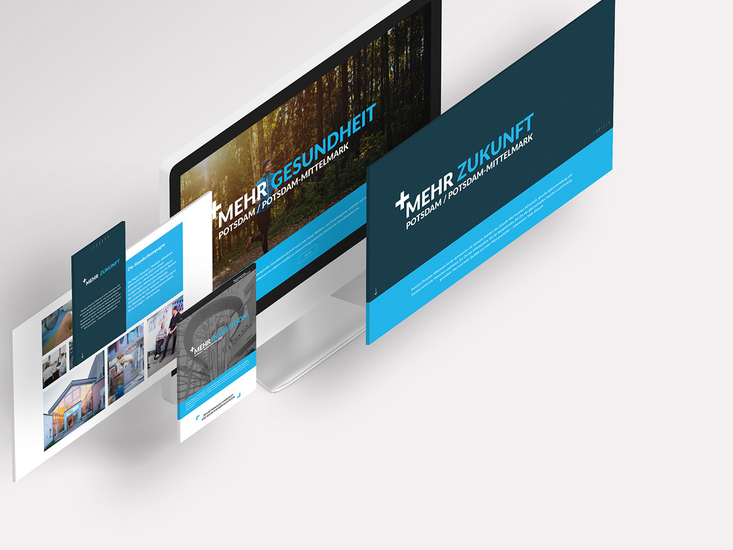Design Thinking
Die Digitalisierung mischt die Karten immer wieder aufs Neue. Das wirft Fragen auf: Bleibt Bewährtes bewahrenswert? Bin ich mit meinen Produkten und Leistungen weiterhin marktfähig? Wie steigere ich meine Innovationsfähigkeit?
Innovation im Zeichen der Nutzer:innen
Nutzer:innen ins Zentrum allen Denkens stellen: Das ist der Ansatz von Design Thinking. Eine Methode, die wir seit über 25 Jahren praktizieren – schon lange bevor sie unter diesem Begriff in den Fachbüchern landete. Design Thinking wird als Prozessmodell beschrieben, das aus mehreren Phasen besteht. Das gängigste Modell – das der Stanford University beziehungsweise des Hasso-Plattner-Instituts – spricht von: Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Ideen finden, Prototypen entwickeln und Testen.
Design Thinking hilft Unternehmen und Organisationen dabei, Antworten auf komplexe Fragestellungen zu finden sowie zielgruppenfokussierte Lösungen für Produkte oder Dienstleitungen zu entwickeln. Es geht darum, in einem iterativen Prozess gemeinsam das beste Ergebnis zu erzielen – ob digitale Lösungen für Personaler, KI-gestützte Redaktionsprozesse oder nutzerzentrierte Anwendungen.

People, Place and Process
Beim Design Thinking spielen die drei Ps ein wesentlich Rolle: People, Places und Process. Das Team sollte interdisziplinär aufgestellt sein, damit über die eigenen (Fach-)grenzen hinausgedacht wird. Dabei spielen auch die Räumlichkeiten eine wichtige Rolle – Ideen entfalten sich am besten in einer offenen Arbeitsumgebung: einem Ort der Inspiration.
Das Undenkbare denken
In dem sechsstufigen, iterativen Design Thinking-Prozess wird die Problemstellung schließlich durchlaufen und erste Lösungen entwickelt – iterativ: das bedeutet auch, dass verschiedene Phasen mehrmals durchlaufen werden können bis die richtige Lösung gefunden ist. Ganz wichtig dabei ist eine offene Fehlerkultur. Beim Design Thinking geht es auch darum, nicht nur die Grenzen des Machbaren auszuloten, sondern gerade auch darüber hinauszudenken, das Unmöglich zu erproben.
Beim Design-Thinking geht es nicht nur um Design-Fragestellungen, sondern um Innovationen an sich, das Lösen komplexer Probleme. Dazu gehört auch, zu scheitern und den Prozess wieder neu anzustoßen.

Design Thinking als ganzheitliche Innovationskultur
Understand & Observe: Die Lösung beginnt mit der Usability-Analyse. Wir wollen genau wissen, worin die Herausforderung besteht: inhaltlich, technisch, strategisch, ökonomisch. Im Design Thinking-Workshop entwickeln wir User Journeys, erstellen zur Zielgruppenanalyse Personas oder arbeiten mit Praxisbeispielen.
Synthesis: Nach der analytischen Bedarfsermittlung werden die gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert und strukturiert, Anforderungen definiert und Zielgruppenbedürfnisse priorisiert. Ein klarer, gemeinsamer Fokus ist das Fundament erfolgreicher Lösungen. Methoden wie Card Sorting unterstützen bei der Auswertung.
Ideation & Prototyping: Wir nutzen das gesamte Kreativpotenzial, um aus Lösungsansätzen konkrete Prototypen zu entwickeln. Dabei geht es uns bei Design Thinking nicht um Innovation um jeden Preis. Was keine Erfolgsaussichten hat, wird aussortiert. Der iterative Designprozess hilft uns dabei zu verstehen, dass Experimente, Probleme und auch Scheitern einen Prozess ausmachen.
Testing: Prototypen werden direkt von User*innen getestet und von Expert*innen kritisch geprüft: Technologie, Usability, Design, Kommunikation, Marketing. Der empirisch-heuristische Prozess stellt sicher, dass wir Verbesserungen permanent einarbeiten können.
"Mit Design Thinking können wir traditionelle und veraltete Denkmuster hinter uns lassen und eine Kultur schaffen, die fähig ist, die digitale Transformation bestmöglich zu meistern."